Grundlage unserer Gemeinschaft ist der Glauben an Jesus Christus und die Hoffnung auf das Reich Gottes. Aus diesem Glauben heraus engagieren wir uns für Programme und Projekte zur Weitergabe des Evangeliums und für die theologische Ausbildung und Weiterbildung, für Bildungsarbeit und Diakonie.
International
Die Evangelische Mission in Solidarität e. V. (EMS) ist eine internationale Gemeinschaft evangelischer Kirchen und Missionsgesellschaften. Sie vertritt die Anliegen von etwa 25 Millionen Gläubigen in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Europa. Über ihre Mitgliedskirchen und Missionsgesellschaften bestehen weltweit ökumenische Beziehungen zu weiteren Kirchen.
Partnerschaftlich
Alle Mitglieder der EMS arbeiten gleichberechtigt auf Augenhöhe zusammen. Ganz gleich, ob es um theologische, organisatorische oder finanzielle Fragen geht. Sie unterstützen sich gegenseitig und stehen sich in Krisen bei. Sie fördern Partnerschaften, ökumenisches Lernen und gemeinsame missionarische Programme. Die EMS setzt sich über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg für achtsame und respektvolle Begegnungen ein.
Solidarisch
Die EMS setzt sich insbesondere für die Rechte derer ein, die verletzlich, arm und ausgegrenzt sind. Sie fördert Projekte zur Armutsbekämpfung und zum Einsatz für Menschenrechte und für den Frieden. Zur Solidarität gehört auch das gemeinsame Engagement für den Erhalt der Schöpfung.

Evangelium

Mission
Die EMS schafft Orte der Begegnung. Wir unterstützen den weltweiten Austausch von Personal, begleiten Partnerschaften und fördern ökumenisches Lernen und interkulturellen Austausch. Wir unterstützen unsere Mitglieder in der Aufarbeitung ihrer Missionsgeschichte.

Solidarität
Die Mitgliedskirchen und Missionsgesellschaften der EMS bezeugen die verändernde Kraft der Liebe Gottes. Sie engagieren sich gegen Armut, für eine bessere Gesundheitsversorgung und Bildung. Sie setzen sich ein für Frieden, Bewahrung der Schöpfung und interreligiösen Dialog. Sie stärken sich gegenseitig in ihren Aufgaben, verwirklichen gemeinsam Projekte und teilen ihre finanziellen Gaben und fachlichen Kenntnisse. Respekt vor der Kultur der Anderen, geschwisterliche Verbundenheit im Geiste Jesu Christi und gegenseitige Solidarität prägen ihre Arbeit.
Unsere Organisation
In der EMS sind alle Gremien international besetzt. Die Arbeitssprache ist Englisch. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt.
Die Vollversammlung...

…ist das wichtigste Organ der EMS. Hier entscheiden sich die inhaltliche Ausrichtung der Gemeinschaft und ihre langfristige Strategie. Die 30 Mitglieder entsenden 55 Delegierte, die sich alle zwei Jahre treffen.
Der Missionsrat...
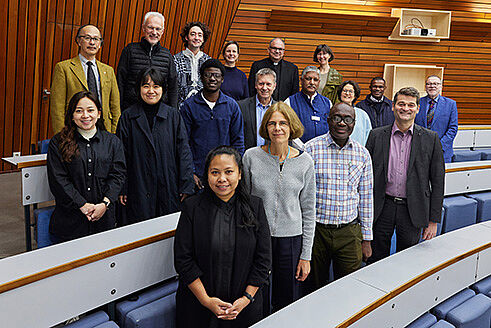
…bildet den internationalen Vorstand der EMS und tagt zweimal im Jahr. Zu ihm gehören 21 Personen. Der Missionsrat fasst grundsätzliche Beschlüsse zu den Programmen der EMS.
Das Präsidium...

…leitet die Vollversammlung sowie den Missionsrat und repräsentiert die EMS nach außen. Die vier Mitglieder des Präsidiums tragen dafür Sorge, dass die Beschlüsse umgesetzt werden. Die Leitung der Geschäftsstelle stimmt sich in wichtigen Fragen mit ihnen ab.
Die Geschäftsstelle

Informationen bündeln, Austausch und Begegnungen ermöglichen, gemeinsame Programme und Projekte realisieren: Das sind die Aufgaben der rund 45 Mitarbeiter*innen in Stuttgart. Sie vermitteln Ökumenische Mitarbeiter*innen in die Mitgliedskirchen, koordinieren den Einsatz junger Erwachsener im Ökumenischen FreiwilligenProgramm, informieren über Anliegen der EMS-Kirchen und Missionsgesellschaften und schaffen Plattformen zur Vernetzung von Christ*innen in aller Welt. Außerdem werben sie Spenden ein und stellen Material für die Gemeindearbeit zur Verfügung. Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle finden Sie hier.
Die Netzwerke

Mission nach unserem Verständnis verändert Menschen, weil sie Horizonte öffnet und ein neues Licht auf Gott und die Menschen wirft. Mission nach unserem Verständnis macht Sinn, weil es um die ganz großen Fragen des Glaubens und des Lebens geht. Mission bringt Menschen zusammen und verbindet. Viele, die mit der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) zu tun hatten, bleiben in internationalen Netzwerken verbunden. Auf diesem Weg sind internationale Netzwerke entstanden für junge Menschen (Jugendnetzwerk), für Frauen (Frauennetzwerk), für Öffentlichkeitsarbeiter*innen (Communicator's Network), für Projektverantwortliche (Networking between EMS Project Partners) oder für ehrenamtlich Engagierte (EMS-Aktive).
Unsere Mitglieder
Die Evangelische Mission in Solidarität e.V. (EMS) setzt sich ein für weltweite Mission und kirchliche Zusammenarbeit. Sie bildet eine Gemeinschaft von von 25 Kirchen und fünf Missionsgesellschaften in zehn Ländern in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Europa. Hier finden Sie grundlegende Informationen zu allen Mitgliedskirchen, Missionsgesellschaften und Gastmitgliedern.
Presbyterianische Kirche von Ghana (PCG)
Die Presbyterianische Kirche von Ghana (PCG) ist die älteste der „Basler Kirchen“. 1828 ging sie aus der Arbeit der Basler Mission hervor. Seit 1926 ist sie selbstständig. Mit ihren rund 800.000 Mitgliedern gehört sie zu den größten evangelischen Kirchen des Landes – und ihre Mitgliederzahl steigt. Grund dafür ist neben der demografischen Entwicklung das große missionarische Engagement.
Mittelpunkt des kirchlichen Lebens sind die Gottesdienste. Gestaltet werden diese vor allem auch von Verbänden für Kinder und Jugend, Männer und Frauen sowie von verschiedenen Musik- und Chorgruppen. Darüber hinaus ist die PCG im Bildungsbereich, in der Friedensarbeit, der ländlichen Entwicklungsarbeit und im Gesundheitsbereich tätig. So ist die Kirche u.a. Trägerin von fünf Krankenhäusern und mehr als 25 kleineren Krankenstationen.
Links
Evangelische Brüder-Unität in Südafrika (MCSA)
1737 landete der Herrnhuter Missionar Georg Schmidt am Kap der Guten Hoffnung. Aus seiner Missionsstation Genadendal ging eine der größten Provinzen der weltweiten Brüder-Unität hervor: die Evangelische Brüdergemeine in Südafrika (MCSA) mit heute über 80.000 Mitgliedern in rund 90 Gemeinden. Verkündigung, Diakonie und Bildung miteinander zu verbinden, das hat sich die MCSA zum Ziel gesetzt. In ihren diakonischen Einrichtungen und in Projekten macht sich die Kirche für Arme und Benachteiligte stark.
Über das Ökumenische Freiwilligenprogramm der EMS leisten junge Menschen soziale Dienste in den Einrichtungen der MCSA, beispielsweise im „Elim Home“ für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Anfang der 2010er Jahren geriet die MCSA zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Pfarrgehälter und die Unterhalts- und Renovierungskosten für Gebäude überforderten die Finanzkraft der Kirche. Dank der Unterstützung der EMS-Gemeinschaft ist der Bestand der Kirche mittlerweile gesichert.
Kirche von Südindien (CSI)
Die Kirche von Südindien (CSI) ist die größte Mitgliedskirche der EMS-Gemeinschaft und eine der größten christlichen Kirchen Asiens. 3.500 Pfarrer*innen arbeiten in 15.000 Gemeinden mit fast vier Millionen Gemeindegliedern. Die Gemeinden sind in 24 Diözesen organisiert, die in den fünf südlichen Bundesstaaten Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu und Kerala liegen. Die meisten Gemeindeglieder leben in ländlichen Gebieten. Drei Viertel von ihnen sind Dalits, Angehörige einer Bevölkerungsgruppe, die außerhalb des traditionellen Kastensystems steht und früher als „Unberührbare“ bekannt war.
Die CSI ist eine unierte Kirche. Sie vereint reformierte, methodistische und anglikanische Traditionen. Einige ihrer Gemeinden sind aus der Arbeit der Basler Mission entstanden, die seit 1834 in Indien tätig ist. Diakonie, Mission und Evangelisation, Ökologie, pastorale Fragen und Jugend- sowie Frauenarbeit sind Arbeitsbereiche der Kirche.
Links
Christlich-Evangelische Kirche in Halmahera (GMIH)
Auf den Molukken zeigt sich die Fragilität des indonesischen Staates. Die Inselgruppe zwischen Sulawesi und Neuguinea galt lange als Musterbeispiel religiöser Toleranz und friedlichen Zusammenlebens. 1999 jedoch kollabierte dieses System. Ethnische und religiöse Konflikte brachen aus. Bis 2002 flohen tausende Menschen vor der Gewalt. Die Christlich-Evangelische Kirche in Halmahera (GMIH), der größten Molukken-Insel, die seit 1949 als selbstständige Kirche geführt wird, geriet dadurch in große Existenznöte. Seitdem hat die Kirche umfangreiche Aufbauarbeit geleistet, in vielen Gemeinden gibt es wieder reges Leben. 150.000 Menschen in 157 Gemeinden gehören ihr an.
Christlich-Protestantische Kirche in Bali (GKPB)
Am 11. November 1931 wurden zwölf Männer und Frauen im Yeh-Poh-Fluss getauft. Dies gilt als Gründungstag der Christlich-Protestantischen Kirche in Bali (GKPB). Heute zählt die Kirche 14.000 Mitglieder. Insgesamt hat Bali vier Millionen Einwohner. Neben der GKPB gibt es 60 weitere Denominationen auf der Insel, denen etwa 42.000 Christ*innen angehören.
Die GKPB sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, die Einheit der Kirche zu wahren. Deshalb gründet sie keine Gemeinden außerhalb der Insel, obwohl mehr als 75 Prozent der balinesischen Christ*innen nicht auf Bali leben. Die Kirche empfiehlt ihnen, Mitglieder der örtlichen Gemeinden zu werden, wo immer sie auch leben. Durch diese Haltung will sie den anderen Kirchen und Nationen ihren Segen erteilen.
Christlich-Evangelische Kirche in Minahasa (GMIM)
Die Christlich-Evangelische Kirche in Minahasa (GMIM) im Norden der Insel Sulawesi ist eine der großen Volkskirchen Indonesiens. Ihr gehören rund 70 Prozent der Bevölkerung in der Region an. Mit ihrer christlichen Universität, einem Krankenhaus und dem Zentrum für die dörflichen Gesundheitsdienste, mit Schulen und Fachschulen trägt die GMIM wesentlich zum gesellschaftlichen Leben bei.
Der Protestantismus in Minahasa geht auf die Missionsarbeit der „Gesellschaft Niederländischer Missionare“ im 19. Jahrhundert zurück. 1934 wurde die GMIM selbstständig. Sie besteht heute aus etwa 800.000 Mitgliedern in mehr als 800 Gemeinden. 450 Pfarrer und knapp 1.000 Pfarrerinnen betreuen die Gläubigen. Frauen haben in der Kultur der Minahasa traditionell eine starke Stellung.
Christliche Kirche in Südsulawesi (GKSS)
Die Geschichte der Christlichen Kirche in Südsulawesi (GKSS) ist vom Zusammenleben und den Konflikten mit Muslimen geprägt. Sie begann im 19. Jahrhundert als Teil der niederländischen Beamtenkirche und wurde 1949 selbstständig. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren ihre Mitglieder der Verfolgung ausgesetzt, ihre Zahl schrumpfte von 10.000 auf nur mehr 600 im Jahr 1952. Heute gehören ihr gut 6.000 Menschen an – meist Bauernfamilien. Die Kirche arbeitet intensiv daran, die Lebensbedingungen ihrer Mitglieder zu verbessern. Sie unterhält unter anderem zwei Wohnheime für Schülerinnen und ein Trainingszentrum für dörfliche Entwicklungsarbeit.
Protestantisch-Indonesische Kirche in Luwu (GPIL)
Die Protestantisch-Indonesische Kirche in Luwu (GPIL) ist eine Kirche im kleinbäuerlichen Umfeld. Sie hat etwa 20.000 Mitglieder. Viele der 114 Gemeinden liegen in abgelegenen Bergregionen und sind nur zu Fuß erreichbar. Für die Menschen dort sind die Bildungsprogramme und die geistliche Unterstützung durch ihre Kirche sehr wichtig. Dank der EMS-Gemeinschaft haben sie Anteil an der weltweiten Ökumene.
Luwu ist der größte Landkreis der Provinz Südsulawesi und umfasst das frühere Herrschaftsgebiet eines Toraja-Königs. Niederländische Missionare, die das gesamte Toraja-Gebiet betreuten, wirkten Anfang des Jahrhunderts auch in Luwu. Die hier entstandenen Gemeinden trennten sich 1966 von der Toraja-Mutterkirche, um sich als selbstständige Kirche ganz auf Luwu zu konzentrieren.
Protestantisch-Indonesische Kirche in Donggala (GPID)
Die Protestantisch-Indonesische Kirche in Donggala (GPID) ist jung. Sie wurde erst 1965 gegründet, um Christ*innen aus verschiedenen ethnischen Gruppen zu vereinen. Die Kirche, die in Zentralsulawesi beheimatet ist, besteht aus 170 Gemeinden mit rund 32.000 Mitgliedern, die von etwa 90 Pfarrer*innen versorgt werden. Sie betreibt mehrere Schulen und ein Erwachsenenbildungszentrum.
Ursprünglich gehörten die Gemeinden zur Christlich-Evangelischen Kirche in Minahasa (GMIM), einer Kirche im äußersten Norden Sulawesis. Seit dem 19. Jahrhundert siedelten Lehrer*innen und Beamte aus der Region Minahasa nach Donggala um. Sie wurden anfangs von minahasischen Pfarrer*innen der dort etablierten protestantischen Kirche betreut, später von der GMIM selbst. Aufgrund der Entfernung wurden die Gemeinden 1965 in einer eigenen Kirche zusammengefasst.
Protestantische Kirche in Südostsulawesi (GEPSULTRA)
1915 nahmen niederländische Missionare in Südostsulawesi ihre Arbeit auf. Erste Gemeinden entstanden. 1942 unterbrach der Zweite Weltkrieg ihre Arbeit: Auf Anordnung der japanischen Besatzer verließen die Missionare das Land, kehrten jedoch nach dem Krieg zurück. Aus ihrem Bemühen ging 1957 die Protestantische Kirche in Südostsulawesi (GEPSULTRA) hervor.
In den ersten zehn Jahren ihres Bestehens war die Kirche Angriffen einer militanten regionalen muslimischen Bewegung ausgesetzt und kämpfte um ihr Überleben. Erst Ende der 1960er Jahre wurde das Leben für die Christ*innen einfacher. Die GEPSULTRA konnte ihre zerstreuten Gemeinden zusammenführen und bekam Zuwachs durch Zugewanderte aus anderen Regionen Indonesiens. Derzeit vereinigt sie Angehörige von 14 verschiedenen Volksgruppen. Sie zählt rund 36.000 Mitglieder in 127 Gemeinden.
Toraja Kirche (GT)
Ein Tauf-Akt markiert den Beginn der Toraja Kirche (GT) in der Provinz Südsulawesi: 20 Angehörige des Toraja-Volkes ließen sich im Mai 1913 von einem Lehrer der holländischen kolonialen Beamtenkirche taufen. Heute zählt die presbyterial-synodal verfasste Kirche rund 650.000 Mitglieder in mehr als 700 Gemeinden. In ihrem Kerngebiet, dem Toraja-Bergland, bekennen sich drei Viertel der Bevölkerung zum christlichen Glauben.
Dazu kommen Gemeinden in verschiedenen Regionen Südsulawesis sowie auf einigen Inseln. Dort sind die Christ*innen in der Minderheit. Sie erfahren die Unruhen und Spannungen zwischen Menschen christlichen und muslimischen Glaubens in der indonesischen Gesellschaft derzeit hautnah. Es ist deshalb ein großes Anliegen der Toraja Kirche, dass Demokratie und Religionsfreiheit in dem Vielvölkerstaat erhalten bleiben.
Toraja Mamasa Kirche (GTM)
Die Toraja Mamasa Kirche (GTM) geht auf die Arbeit niederländischer Missionare zurück und ist seit 1947 selbständig. Zwei Drittel ihrer Mitglieder leben im abgelegenen Hochtal von West-Toraja in West-Sulawesi, weitere Gemeinden sind in Süd-Sulawesi, in der Hauptstadt Jakarta und in Palu in Zentral-Sulawesi entstanden. Die Toraja Mamasa Kirche besteht aus etwa 135.000 Mitgliedern in 577 Gemeinden und 65 Dekanaten. Sie beschäftigt rund 170 Pfarrer*innen.
Als größte Religionsgemeinschaft in der Region sieht sich die Toraja Mamasa Kirche in der Verantwortung, das gesellschaftliche Miteinander mitzugestalten. Deshalb engagiert sie sich unter anderem in der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung. Auch für die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur in der Region macht sich die GMT stark: Sie unterhält verschiedene Schulen, ein landwirtschaftliches Entwicklungszentrum sowie ein Krankenhaus.
Vereinigte Kirche Christi in Japan (KYODAN)
Nur etwa ein Prozent der japanischen Bevölkerung bekennen sich zum christlichen Glauben, unter ihnen sind 650.000 Protestant*innen. Etwa 200.000 Protestant*innen gehören der Vereinigten Kirche Christi in Japan (KYODAN) an – mit rund 1.700 Gemeinden und rund 2.200 Pfarrer*innen die größte protestantische Kirche des Landes.
Der KYODAN ist eine missionarische Kirche, die viel Wert auf Evangelisation legt. Er ist aber auch eine politische Kirche, die zu gesellschaftlichen Fragen Stellung bezieht – etwa wenn es um die Mitverantwortung für die Gräuel japanischer Truppen während des Zweiten Weltkrieges geht. Engagement für Frieden, Versöhnung und Umweltschutz gehört zur Identität der Kirche: 2014 organisierte der KYODAN die internationale Konferenz „Gegen den Mythos von der Sicherheit atomarer Energie“ und sprach sich deutlich gegen Atomenergie aus.
Links
Presbyterianische Kirche in der Republik Korea (PROK)
Mit rund 340.000 Mitgliedern und etwa 1.450 Gemeinden gehört die Presbyterianische Kirche in der Republik Korea (PROK) zu den kleineren Kirchen Südkoreas – einem Land, in dem sich mehr als ein Viertel der Bevölkerung zum christlichen Glauben bekennt. 1.900 Pfarrer*innen und über 2.800 Kirchenälteste versehen den Dienst in den Gemeinden.
Menschenrechte, Demokratisierung, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel: Für die PROK sind das keine Schlagworte, sondern Teil ihres Selbstverständnisses. Dieses hat seine Wurzeln vor allem in der Zeit wechselnder Militärdiktaturen in den 1970er und 1980er Jahren. Außerdem beschäftigt sich die Kirche mit Themen wie Ökologie und nachhaltige Entwicklung.
Links
Presbyterianische Kirche von Korea (PCK)
In Südkorea gehören mehr als ein Viertel der Bevölkerung einer christlichen Kirche an, 19 Prozent sind Protestant*innen. So hoch ist ihr Anteil in keinem anderen Land Asiens. Die Presbyterianische Kirche von Korea (PCK) besteht aus 6.300 Gemeinden mit mehr als 2,2 Millionen Mitgliedern und rund 8.600 Pfarrer*innen. Sie ist damit eine der größten Kirchen des Landes.
Die PCK vereint in sich eine Vielzahl von Anliegen. Einen großen Stellenwert haben die Themen Evangelisation und Weltmission: Derzeit sind in ihrem Auftrag etwa tausend Missionar*innen in 82 Ländern tätig. Gleichzeitig betont die PCK auch die Verantwortung für die Schöpfung. Die Kirche setzt sich für einen umweltfreundlichen, nachhaltigen Lebensstil sowie für Frieden und Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel ein.
Links
Evangelische Landeskirche in Baden (EKIBA)
Die Evangelische Landeskirche in Baden (EKIBA) hat etwa 1,13 Millionen Mitglieder in 640 Gemeinden und 24 Kirchenbezirken. Der Sitz der Kirchenleitung ist in Karlsruhe. Rund 1000 Pfarrer*innen predigen in den Gemeinden, geben Religionsunterricht und tragen die überregionalen Dienste – gemeinsam mit vielen Haupt- und Ehrenamtlichen. Deren Engagement ist besonders in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Rahmen der Kirchenmusik unverzichtbar.
Vor rund 200 Jahren ist die EKIBA als unierte Kirche mit lutherischer und reformierter Tradition entstanden. In der Unionsurkunde von 1821 heißt es: Sie sei „in sich einig und mit Christen in der ganzen Welt befreundet.“ Dieses ökumenische Bekenntnis ist wegweisend. Menschen unterschiedlicher Frömmigkeit eine geistliche Heimat zu bieten und die Gemeinschaft mit Christ*innen weltweit zu suchen, ist bis heute zentrales Anliegen der Kirche.
Links
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
Verkündigung, Bildung, Seelsorge, gesellschaftliche Verantwortung und Ökumene: Das sind die zentralen Handlungsfelder der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Sie ist eine unierte Kirche mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern in 1.132 Kirchengemeinden. Diese stehen in lutherischer, reformierter oder unierter Bekenntnistradition. Die Arbeit in den Regionen geschieht in 35 Dekanaten in fünf Propsteien.
Ziele des ökumenischen Engagements der EKHN sind die Gemeinschaft der Christenheit und eine weltweite Solidarität. Der größte Schatz der Kirche sind ihre Mitglieder: Über 73.000 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und rund 1.550 Pfarrer*innen engagieren sich in Gemeinden, Gruppen und Kreisen. In knapp 600 Kindertagesstätten erfahren rund 40.000 Kinder Zuwendung.
Links
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)
Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) liegt in der Mitte Deutschlands. Rund 812.000 Gemeindeglieder leben in 756 Kirchengemeinden, die meisten davon in ländlichen Regionen. Hier sind die volkskirchlichen Strukturen noch recht stabil. Etwa 950 Pfarrer*innen arbeiten in den Gemeinden und im übergemeindlichen Dienst wie Klinikseelsorge, in Schulpfarrämtern oder in der Frauenarbeit. Dazu kommen rund 25.000 Mitarbeitende in Kirche und Diakonie.
Die EKKW möchte weiterhin nah bei den Menschen sein. Deshalb durchläuft sie derzeit einen Reformprozess, um auch in Zeiten zunehmender Säkularisierung das Evangelium überzeugend zu leben. Sie ist sich dabei auch der Unterstützung ihrer zahlreichen Partner in der Ökumene gewiss. Gemeinsam mit Christinnen und Christen aus aller Welt tritt die EKKW für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein.
Links
Evangelische Kirche der Pfalz (EKP)
Die Evangelische Kirche der Pfalz (EKP) hat derzeit etwa 515.000 Mitglieder in 402 Gemeinden. Ihre Hauptkirche ist die Gedächtniskirche in Speyer. Ökumene liegt der Evangelischen Kirche der Pfalz besonders am Herzen: Dazu gehören gute Beziehungen zum katholischen Bistum Speyer, aber auch Partnerschaften innerhalb des europäischen und weltweiten Protestantismus.
Dennoch verliert die Landeskirche ihre eigenen Gegebenheiten und Stärken nicht aus den Augen. Unter dem Motto „Heimat – Kirche – Pfalz“ rückt sie die Gemeinden als Orte der Heimat in einer zunehmend unübersichtlichen Welt in den Mittelpunkt. Den Menschen Halt und ein Gefühl des Zusammenhalts zu geben, ist für die Pfälzer Landeskirche ein wichtiges Zukunftsthema.
Evangelische Landeskirche in Württemberg (ELK-WUE)
Zur lutherisch geprägten Evangelischen Landeskirche in Württemberg (ELK-WUE) gehören knapp zwei Millionen Christ*innen in rund 1.300 Kirchengemeinden. Sie ist die sechstgrößte der insgesamt 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Hauptkirche der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist die Stiftskirche Stuttgart.
Eine Besonderheit der Kirche ist ihre enge Verbindung mit dem Pietismus, einer protestantischen Erweckungs- und Reformbewegung, die im 17. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Viele württembergische Missionar*innen, die das Evangelium im Auftrag der Basler Mission nach Afrika und Asien trugen, waren im Pietismus verwurzelt. Sie legten den Grundstein zum Aufbau einheimischer Kirchen z.B. in Indien und Ghana. Noch heute pflegt die Württembergische Landeskirche zahlreiche Beziehungen zu ökumenischen Partnern weltweit.
Links
Herrnhuter Brüdergemeine
Die Herrnhuter Brüdergemeine ist bekannt für ihr Losungsbuch, das mittlerweile in 60 Sprachen übersetzt wird. Weniger bekannt ist, dass sie Teil einer von 29 Kirchenprovinzen der Evangelischen Brüder-Unität ist. Diese zählt weltweit mehr als eine Million Mitglieder. In Deutschland gehören ihr etwa 5.800 Menschen an.
Die Wurzeln der Brüdergemeine liegen in der tschechischen Reformation des 15. Jahrhunderts sowie im deutschen Pietismus des 18. Jahrhunderts. Prägende Gestalt war Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Auf dessen Landgut in der Oberlausitz gründeten mährische Glaubensflüchtlinge im Jahr 1722 den Ort Herrnhut. Zehn Jahre später wandten sich die Herrnhuter der Welt zu und begründeten ihre missionarische Arbeit, die bis heute Wesensmerkmal der Brüdergemeine ist.
Bischöfliche Kirche in Jerusalem und dem Mittleren Osten
Sie wird die „Anglikanische“, „Episkopale“ oder „Bischöfliche Kirche“ genannt: Die Diözese „Jerusalem und der Mittlere Osten“ ist aus dem gemeinsamen Preußisch-Anglikanischen Bistum (1841-1886) hervorgegangen. Zu ihr gehören heute über 27 Gemeinden in Israel, Palästina, Jordanien, dem Libanon und Syrien. In einer Region, die massiv von Bürgerkrieg und politischen Konflikten betroffen ist, tritt die Kirche für gegenseitigen Respekt, Versöhnung und Frieden ein.
Die Bischöfliche Kirche hält über die Theodor-Schneller-Schule (TSS) in Amman (Jordanien) engen Kontakt mit der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) und dem Evangelischen Verein für die Schneller-Schulen (EVS). Dazu kommt die „Arab Episcopal School“, eine integrative Schule im jordanischen Irbid, die vor allem blinde und sehbehinderte Kinder aufnimmt. Regelmäßig arbeiten junge Menschen des Freiwilligenprogramms der EMS-Gemeinschaft in beiden Einrichtungen sowie an der Gehörlosenschule „Holy Land Institute for the Deaf“ in Salt (Jordanien).
Nationale Evangelische Kirche in Beirut (NECB)
Klein, aber einflussreich ist die Nationale Evangelische Kirche in Beirut (NECB). Sie wurde 1848 gegründet und genießt vor allem wegen ihrer Bildungsarbeit großes Ansehen. Als Trägerkirche der Johann-Ludwig-Schneller-Schule (JLSS) arbeitet die NECB eng mit dem Evangelischen Verein für die Schneller-Schulen (EVS) zusammen. Sie unterstützt die „Near East School of Theology“ (NEST), eine Ausbildungsstätte der lokalen Kirchen in der Region, an der auch Pfarrer*innen sowie Studierende aus Deutschland ihre Kenntnisse über die Kirchen des Nahen Ostens vertiefen können.
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der NECB ist derzeit die Flüchtlingsarbeit. Die Kirche stellt syrischen Flüchtlingskindern Schulplätze zur Verfügung, bietet alleinerziehenden syrischen Müttern Ausbildungskurse an und hat gemeinsam mit Partnern in Syrien dort eine Vorschule für Binnenflüchtlinge gegründet. Die Kirche ist zudem Trägerin des „Moadieh Evangelical Center“, eines Seniorenheims, das pflegebedürftige alte Menschen aus verschiedenen Religionen beherbergt.
Basler Mission (BM)
Gottes Geist verbindet Menschen – auch über Länder-, Konfessions- und Kulturgrenzen hinweg. Diese Erfahrung prägen die Basler Mission und ihre Nachfolgeorganisationen BMDZ (Deutschland) und Mission 21 (Schweiz) seit über 200 Jahren. 1815 wurde die Basler Mission in der Schweiz gegründet. Ein Jahr später eröffnete sie ein Seminar für angehende Missionare.
Die ersten Seminaristen reisten 1821 in den Kaukasus, später nach Ghana, Indien und China, um den Menschen vom Evangelium Jesu Christi zu berichten. Viele Missionare kamen aus Deutschland, vor allem aus Württemberg. Von großer Bedeutung war die Unterstützung durch schwäbische Pietisten, die für die Mission beteten, spendeten und immer wieder Menschen ermutigten, in die Mission zu gehen. 1954 wurde die „Basler Mission - Deutscher Zweig e.V.“ (BMDZ) mit Sitz in Stuttgart gegründet. Sie knüpft an das historische Erbe der Basler Mission an.
Deutsche Ostasienmission (DOAM)
Die Deutsche Ostasienmission ist ein liberales Missionswerk. 1884 von Schweizern und Deutschen gegründet, legte sie schon immer Wert auf das Studium verschiedener Religionen und den Dialog mit Menschen anderen Glaubens. Kontakte gibt es vor allem nach China und Japan, seit den 1970er Jahren auch nach Korea.
Als Anfang der 1970er Jahre das Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland (heute: Evangelische Mission in Solidarität) und das Berliner Missionswerk gegründet wurden, brachte die DOAM ihre Beziehungen und Programme ein und wurde Teil der neuen Werke. Einige eigene Aufgaben sind jedoch verblieben: Gottesdienste und Veranstaltungen zum Thema Ostasien, eine jährliche Studientagung, ein Infobrief sowie eine eigene Website. Damit beteiligt sich die DOAM am theologischen Gespräch mit und in Ostasien in der Überzeugung, dass sich von Christ*innen aus Ostasien viel lernen lässt.
Im Einsatz für Demokratie, Menschenrechte und Gerechtigkeit ist die Solidarität mit den Benachteiligten in den Gesellschaften und Regionen Ostasiens und Deutschlands ein großes Anliegen der DOAM.
Evangelischer Verein für die Schneller-Schulen (EVS)
Ein Schwabe in Jerusalem: 1854 zog Johann Ludwig Schneller ins Heilige Land. Der Lehrer stammte aus Erpfingen auf der Schwäbischen Alb. In Jerusalem gründete er 1860 das „Syrische Waisenhaus“. Daraus hervorgegangen sind die Johann Ludwig Schneller-Schule im Libanon und die Theodor Schneller-Schule in Jordanien. Kinder aus bedürftigen oder zerbrochenen Familien erhalten dort eine Schul- und Berufsausbildung.
Die Schulen engagieren sich für ein friedliches Miteinander über die Religionsgrenzen hinweg und legen so ein Zeugnis christlicher Nächstenliebe ab. Träger der Einrichtungen sind mittlerweile die lokalen EMS-Mitgliedskirchen im Libanon und in Jordanien. Der Evangelische Verein für die Schneller-Schulen (EVS) sowie die „Schneller-Stiftung – Erziehung zum Frieden“ unterstützen diese Arbeit.
Basler Mission – Deutscher Zweig (BMDZ)
Die Basler Mission – Deutscher Zweig e.V. (BMDZ) hat ihren Sitz in Stuttgart. Sie ist 1954 aus der 1815 gegründeten Basler Mission hervorgegangen und trägt deren historisches Erbe weiter. Die BMDZ arbeitet mit Christ*innen aus aller Welt zusammen. Diese Kontakte und Beziehungen zu Kirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika sind in vielen Jahrzehnten Missionsarbeit gewachsen.
Die BMDZ fördert ihre Partnerkirchen vor allem im Bereich der medizinischen Versorgung benachteiligter Menschen, in der Armutsbekämpfung und Gemeindeentwicklung sowie in der theologischen, schulischen und beruflichen Bildung. Viele Programme unterstützt die BMDZ gemeinsam mit ihrer Schwesterorganisation, dem Schweizer Missionswerk Mission 21 – immer im Wissen, dass ein respektvoller Umgang zwischen unterschiedlichen geistlichen Prägungen und verschiedenen Religionen die Grundlage dieser Arbeit bildet.
Herrnhuter Missionshilfe (HMH)
Die Herrnhuter Missionshilfe (HMH) mit Sitz in Bad Boll ist die Missionsgesellschaft der Herrnhuter Brüdergemeine in Deutschland. Sie unterstützt mehr als 60 Projekte in neun Ländern. Ihre Arbeit geht zurück auf die Missionstätigkeit der Herrnhuter Brüdergemeine, die 1732 mit der Aussendung von Missionaren zu den Sklaven in der Karibik begann und sich seitdem bewährt und weiterentwickelt hat.
Heute pflegt die HMH Beziehungen zu Partnerkirchen in Ost- und Südafrika, Nordindien und Mittelamerika. Im Westjordanland trägt sie Verantwortung für das „Star Mountain Rehabilitation Center", ein Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. In Europa unterstützt sie die Herrnhuter Arbeit in Albanien und Lettland. In Deutschland ist sie Trägerin des Missionsstützpunkts „Haltestelle“ in Cottbus, einem offenen Haus für alle, die den christlichen Glauben kennenlernen und Gemeinschaft erfahren wollen.
Kirche von Nordindien (CNI)
Der Kirche von Nordindien (CNI) gehören rund 2,2 Mio. Menschen in 4.500 Gemeinden an, die von rund 2.150 Pfarrern und 56 Pfarrerinnen geleitet werden. Sie erstreckt sich über 22 der 28 indischen Bundesstaaten. Die CNI entstand 1970 aus sechs Kirchen verschiedener protestantischer Denominationen. Sie ist Trägerin von 65 Krankenhäusern und betreibt rund 560 Sekundarschulen und mehreren beruflichen Ausbildungszentren. Die CNI pflegt seit rund 30 Jahren Partnerschaften mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Ausbildungshilfe der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW).
Links
Christliche Kirche in Westsulawesi (GKSB)
Die Christliche Kirche in Westsulawesi (GKSB) trennte sich 1977 aufgrund der großen räumlichen Entfernungen von der Toraja Mamasa Kirche in Sulawesi. Ihre knapp 20.000 Mitglieder leben in 105 Gemeinden in den ländlichen Gebieten in West-, Süd- und Zentralsulawesi. Sie werden von 44 Pfarrern und fünf Pfarrerinnen seelsorgerlich betreut. Um dem drängendsten Problem, dem großen Pfarrer*innenmangel, zu begegnen, hat die GKSB 2012 ein Theologisches College gegründet, auf dem zurzeit 80 junge Leute studieren.
Unsere Geschichte
Am 16. September 1972 wurde im Hospitalhof Stuttgart das „Evangelische Missionswerk in Südwestdeutschland“ gegründet. 50 Jahre später ist daraus die „Evangelische Mission in Solidarität”. Rückblick in drei Kapiteln.
Mit wem wir zusammenarbeiten
Die Evangelische Mission in Solidarität bringt sich bewusst in die Zusammenarbeit mit Anderen ein. Wir bündeln unsere Kräfte und handeln solidarisch.
Grundsatzdokumente
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der gültigen Grundsatzdokumente der Evangelischen Mission in Solidarität. Grundsatzdokumente sind wichtige Rechtsvorschriften, Leitfäden und andere Vorgaben.
- Satzung (pdf, 327 KB)
- Strategie 2021-2026 (pdf, 1 MB)
- Theologische Orientierung (pdf, 255 KB)
- Anti-Korruptionspolicy (pdf, 278 KB)
- Schutzkonzept (pdf, 267 KB)
- Policy zur finanziellen Förderung von Programmen und Projekten (pdf, 271 KB)
- Nachhaltigkeitsbericht 2024 (pdf, 3 MB)
- Aktualisierte Umwelterklärung 2025 (pdf, 906 KB)
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Bei allgemeinen Fragen nutzen Sie bitte das unten stehende Kontaktformular. Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung – telefonisch oder per E-Mail.
Andrea Braun-Krier
Sachbearbeiterin Generalsekretariat
+49 711 636 78 -23
Wie wir uns finanzieren
Gelebte Solidarität und eine weltweite christliche Gemeinschaft leben auch von einem verantwortlichen Umgang mit Kollekten, Spenden und Beiträgen
Im Gleichnis vom anvertrauten Geld im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums analysiert der zurückgekehrte Geldgeber die Erträge seiner Investoren. Die Wagemutigen haben das Vermögen verdoppelt, der ängstlich Konservative hat das Kapital gerade mal erhalten. Auch uns stellt sich die Frage: Wie gehen wir mit dem uns anvertrauten Geld um? Auch wir von der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) müssen Rechenschaft ablegen über das Geld, das uns von unseren Mitgliedskirchen und Spender*innen anvertraut wurde. Es ist uns nicht geschenkt worden. Vielmehr ist es uns im Vertrauen auf eine sorgsame und wirkungsvolle Verwendung im Rahmen unseres vorgegebenen Auftrags überlassen worden: die kleinen und großen Spenden, die Kollekten und Sammlungen und die unsere Arbeit tragenden Zuweisungen unserer Mitgliedskirchen und Missionsgesellschaften. Im Vertrauen darauf, dass christliche Gemeinschaft und gelebte Solidarität möglich werden.
Die Kontroll- und Leitungsgremien der EMS überwachen den Umgang mit dem anvertrauten Geld. Aber auch jeder*r einzelne Mitarbeitende muss sich immer wieder die Frage nach dem sorgsamen und pflichtbewussten Umgang mit finanziellen Mitteln stellen.
Als Mitglied des Arbeitskreises Kirchlicher Investoren (AKI) verpflichten wir uns zur konkreten Umsetzung ethisch-nachhaltiger Geldanlagen. Geld soll unter Berücksichtigung christlicher Werte sicher und rentabel, aber auch sozialverträglich, ökologisch und generationengerecht angelegt werden. Der „Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der Evangelischen Kirche“ informiert über Ziele, Instrumente und konkrete Umsetzungen ethisch-nachhaltiger Geldanlagen.
Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche
Leitfaden des Arbeitskreises Kirchlicher Investoren (AKI) im Auftrag der EKD
Arbeitskreis kirchlicher Investoren (AKI)
Transparenz
Ihr Engagement als Spender*in und Unterstützer*in trägt maßgeblich dazu bei, dass die Arbeit unserer kirchlichen Gemeinschaft und ihre Projekte wirksam umgesetzt werden können. Das entgegengebrachte Vertrauen wissen wir sehr zu schätzen und verstehen es als besondere Verantwortung.
Aus diesem Grund beteiligen wir uns an der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Ihr zentrales Leitmotiv lautet: Transparenz schafft Vertrauen.
Im Rahmen dieser freiwilligen Selbstverpflichtung legen wir unsere Arbeitsweise offen. Auf dieser Seiten finden Sie in zehn übersichtlich dargestellten Punkten Informationen darüber, woher unsere finanziellen Mittel stammen, wie sie eingesetzt werden und wie unsere Organisation strukturiert ist.
Mehr zum Thema Transparenz in der EMS
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Bei allgemeinen Fragen nutzen Sie bitte das unten stehende Kontaktformular. Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung – telefonisch oder per E-Mail.
Ute Kauffmann
Geschäftsführerin, Abteilungsleiterin Verwaltung und Finanzen
+49 711 636 78 -15
Die Vereine
Die Evangelische Mission in Solidarität e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. Sie ist sowohl ein Verein mit eigenen Aufgaben als auch Dach für die Missionsvereine, die Mitglied in der EMS sind. Dies sind die Basler Mission – Deutscher Zweig (BMDZ), die in vielen Regionen Südwestdeutschlands durch ihre 200-jährige Geschichte fest verankert ist, der Evangelische Verein für die Schneller-Schulen (EVS) mit seiner anerkannten Bildungsarbeit im Nahen Osten und die Deutsche Ostasienmission (DOAM), die von Anfang an das interkulturelle Lernen zum Programm erhoben hat.
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Bei allgemeinen Fragen nutzen Sie bitte das unten stehende Kontaktformular. Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung – telefonisch oder per E-Mail.


























































